Erschienen im Heft 12 der Revolver, Zeitschrift für Film, 2005
In Großaufnahme neben der Kamera herlaufend, ohne Pause, laufend, laufend, laufend blinzelt sie zwischen Sekunde sieben und Sekunde zwölf nur einmal, und meine Wahrnehmung kippt, aus der Geschichte, zum Menschen, der Schauspielerin privat in ihrer Rolle in diesem Moment, als ginge sie neben mir und ich sähe sie an und beobachtete, unabhängig vom Vorher und Nachher, aus dem Moment heraus, wie sie läuft, in Gedanken, die Haare im Wind, sich räuspernd, verlangsamt zur Zeitlupe, aus der Erzählung gerissen, wie in der Langzeitbelichtung eines Photos macht meine Wahrnehmung eine Art Quantensprung in ihre Gegenwart, ihr Jetzt – jenen unendlich kurzen Augenblick, der in meinem Bewusstsein zu einem Zeitraum verlängert spürbar wird, in dem der Berg, den Sisyphos erklimmt, eine Kugel wird, der Moment des Herabrollens nicht mehr existiert und somit keine Narration, sondern ein anstrengungsloser Zustand, ohne Wertung und Richtung, nur der Körper sinnlos und vergänglich, er selbst – bevor die Erzählung wieder beginnt.
Räuber und Gendarm. Er rennt voraus. Durch die Tür vom Dachboden ins Treppenhaus, nach unten. Ich will schneller sein, schwinge mein Bein übers Geländer, um zu rutschen. Aber ich bin zu schnell. Kein Gleichgewicht. Mein Bein findet keinen Halt mehr. Ich rufe irgend etwas, kann mich noch kurz an den Sprossen des Geländers halten. Den Kopf nach hinten gereckt sehe ich am Geländer vorbei die rissige Decke des Treppenhauses, dann lasse ich los. Ich erinnere mich an das Rauschen der Luft in den Ohren und den Luftzug im Gesicht. Das Treppenhaus ist etwa 8 Meter hoch, der Zwischenraum zwischen den Geländern vielleicht 40 cm breit. Ich falle schnurgerade und lande auf einer Holztruhe.
Meine Erinnerung endet hier, aber wenn ich davon erzähle, sehe ich Florian, wie er nach unten kommt, mich in einer Blutlache auf der Truhe liegen sieht, zu meiner Mutter rennt, wie ihr Gesicht blass wird und sie ihren kurzen, charakteristischen Einatmer mit aufgerissenen Augen macht, der bei ihr großes Erschrecken bedeutet usw. In der Erinnerung habe ich daraus ein kleines Drama gemacht mit Anfang, Mitte und Ende, wie sich das gehört. Alles hat Sinn. Im Moment, als es geschah, war davon nichts zu spüren, da war nur die Überraschung, der Schreck, die eckigen Geländerstäbe in meinen Händen und der Riss in der Decke. Selbst die Angst kam später. Das Drama habe ich retrospektiv geschrieben, habe geordnet, zensiert, dramatisiert, wie wir es ständig tun, wenn Wahrnehmungen aus dem, was wir als Gegenwart empfinden, in den Bereich der Vergangenheit kippen. Plötzlich wird alles sinnhaft, bezogen, ungleichzeitig – erzählt. Die Vergangenheit wird zum Roman, zur Legende, belegt durch eine Ansammlung von Reliquien. Mein Sturz durchs Treppenhaus könnte nur eine Geschichte, eine Fiktion sein, ein Lehrstück vielleicht, über die Gefahr des Leichtsinns, und ich selbst wäre nur Teil einer Erzählung meiner selbst. Die kleine Narbe unter der Lippe bräuchte dann eine neue Begründung und meine Erinnerung wäre „nur“ ein Traum. Warum nicht.
Sie liegt nicht da, wie sonst – viel gerader, fast rechtwinklig. Die Kleider scheinen ihr nicht zu passen, weil sie nicht über etwas Weiches fallen. Der Tod hat ihr die Weichheit genommen. Der Duft des Öls im Raum macht mir Angst. Er ist dumpf und legt sich so eng um mich wie der weiche Händedruck derer, die mit ihrem Tod umgehen können, als wäre er schon lange her, als gehöre der Tod zum Leben. Aber das tut er nicht. Zum ersten Mal wird mir klar, wie dunkel diese Grenze ist, wie undurchdringlich für die Augen der Lebenden. Der Tod ist nur Nicht-Leben. Wie in der Mengenlehre ist das Leben „A“, der Tod „Nicht-A“, alles ausser A. Ähnlich wie die Erde und das Universum um sie herum, aber ihr Tod hat keine Sterne und keine Sonnen. In ihr reflektiert und leuchtet nichts zu mir nach außen, um nicht zu sagen nach innen, weil der Tod das Außen ist. An ihren Augen sieht man es deutlich, weil sie ihr Leben lang geleuchtet haben.
Gleichzeitig ist die Stille im Zimmer auch Ruhe. Eine Ruhe, wie man sie im Leben nie erreichen kann, strahlt von ihr aus. Diese totale, grenzenlose Ruhe im Tod erscheint mir als das einzige wirkliche Ziel im Leben, weil der Mensch erst dann das aufhört, was ihn täglich beglückt, schmerzt, antreibt – er hört auf zu leben. In den langen Momenten, in denen mir ihre regungslose Anwesenheit wirklich vorkommt, schäme ich mich dafür überhaupt zu denken, nicht nur bei ihr zu sein. Dann denke ich an meine Arbeit, an meinen Film, die Geschichte, an sie in dieser Geschichte. Ihr Tod kommt im Film nicht vor, und das ist gut so. Mir wird klar, dass der Film den Tod nicht greifen könnte. Die Liebe wie den Tod glauben wir aus der Erzählung heraus zu verstehen, interpretieren, antizipieren zu können – empathisch wie wir sind. Aber dem Tod ist mit Empathie nicht beizukommen. Der Tote ist kein Adressat. Sie, mit der wir gelebt haben, kommt gut ohne uns zurecht, besser als je zuvor. Der Tod ist das Gegenteil von Erzählung, nur Zustand und wird somit im Film zwangsläufig zum Zeichen. Die Erzählung ihres Lebens mit ihrer Vergangenheit, ihren Wünschen, Enttäuschungen, Zukunft und Gegenwart, trennt sich als Produkt des Körpers im Tod von ihr als Erzählerin und wird zu unserer Erzählung von ihr. Das wirkliche Drama hat aber in ihrem Leben selbst bestanden, in jedem Moment, jeder Wahrnehmung und Entscheidung. Alle unsere Geschichten brechen sich an der Gegenwart, an jedem neuen Augenblick, in dem ein Mensch handelt und auch der Film ist davor kein Fluchtweg, sondern nur ein Stück Leben im Angesicht einer Leinwand. In ihrer Sinnlosigkeit bildet die Kunst diesen Zustand ab. Film nicht im Sinne einer Geschichte, sondern im Sinne der Gegenwart oder vielleicht des Todes zu betrachten, würde auch bedeuten, in ihm keinen Mehrwert zu suchen, sondern nur den Ausdruck eines anderen Menschen wahrzunehmen, wie man auch den Menschen selbst wahrnimmt. Film ist dann eine Hülle wie ihre Haut, hinter der kein Leben mehr ist, sondern nur noch Erzählung, und die Frage nach dem Anfang und dem Ende der Narration ist die Frage nach dem Anfang und Ende des Lebens. Sie beginnt und endet mit ihm.
Benjamin Heisenberg





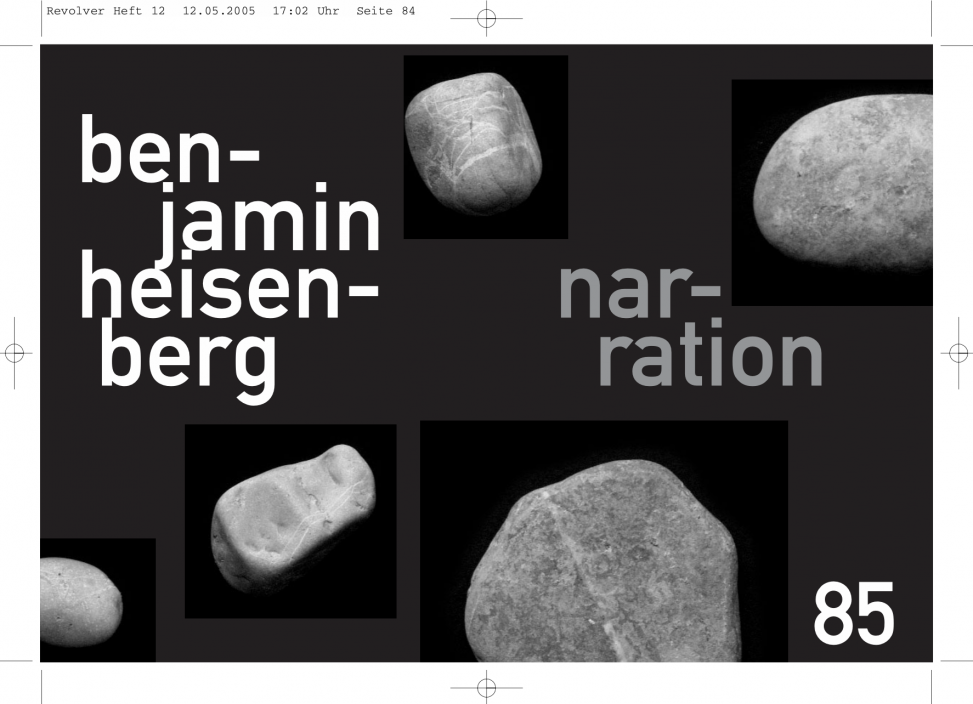
Schreibe einen Kommentar